Grenzen setzen – Selbstfürsorge statt Egoismus
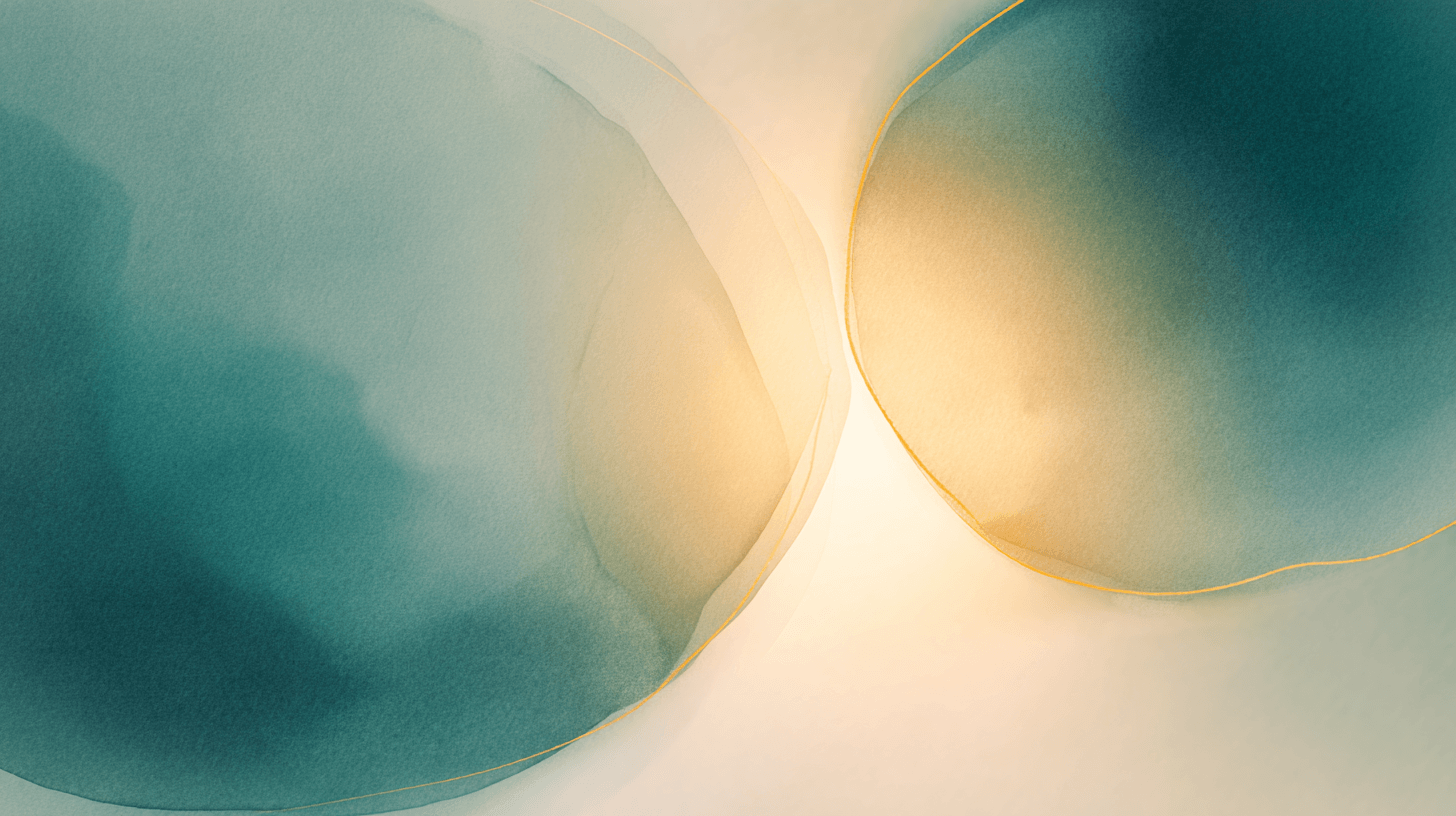
Kurzfassung: Gesunde Grenzen sind keine Mauern, sondern Kontaktflächen. Sie trennen nicht, sondern machen echte Begegnung erst möglich – mit uns selbst und mit anderen. Dieser Artikel zeigt, wie Sie durch Körperwahrnehmung und bewusste Kommunikation lernen, klare Grenzen zu setzen – in Beziehungen, mit Kindern und im Beruf.
1 | Grenzen als psychologische Grundstruktur
Grenzen sind ein universelles psychologisches Prinzip – sie strukturieren unser Erleben, unser Selbst und unsere Beziehungen.
Egal, ob im Kontakt mit dem Partner, mit Kindern oder im beruflichen Umfeld: Die Fähigkeit, gesunde persönliche Grenzen wahrzunehmen, zu kommunizieren und zu wahren, beruht immer auf denselben inneren Prozessen.
In der Psychologie lassen sich persönliche Grenzen als die Schnittstelle zwischen „Ich" und „Du" verstehen – also als die bewusste Wahrnehmung dessen, wo mein Raum endet und der des anderen beginnt. Als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit ganzheitlich-humanistischem Ansatz widme ich insbesondere dem Körper und der Körperwahrnehmung meine Aufmerksamkeit, um psychologische Phänomene zu erklären und Übungen zum Grenzen setzen anzubieten.
2 | Embodiment – Grenzen beginnen im Körper
Ein moderner Zugang zum Thema Grenzen findet sich im Embodiment-Ansatz, der davon ausgeht, dass Körper und Psyche untrennbar miteinander verbunden sind. Unsere Grenzen sind keine rein mentalen Konstrukte, sondern gelebte, spürbare Erfahrungen.
Druck auf dem Brustkorb, Spannung in den Schultern, ein zitternder Kiefer, ein Schlag in den Magen oder ein inneres „Stopp"-Empfinden sind körperliche Signale, die darauf hinweisen, dass unsere Grenze berührt oder überschritten wird.
- Eine Enge in der Brust kann anzeigen, dass wir uns überfordert fühlen.
- Druck im Bauch oder flache Atmung können ein Hinweis sein, dass wir etwas „ertragen", statt in Kontakt zu bleiben.
- Ein Gefühl von Weite oder Wärme zeigt oft, dass wir in stimmigem Kontakt sind.
Viele Menschen haben gelernt, solche Empfindungen zu übergehen oder zu unterdrücken – aus Angst, empfindlich, schwach oder „zu emotional" zu wirken. Und gleichzeitig glauben sie, das sehr unangenehme Gefühl schnell wegdrücken zu müssen, um zu reagieren. Eltern zum Beispiel, die sofort und ungebremst auf Verhalten der Kinder reagieren, was dann zu extremen Gegenreaktionen führen kann wie Wut, Weinen oder Wegrennen.
In Wahrheit ist es jedoch genau umgekehrt:
Wer seine körperlichen Signale wahrnimmt, übernimmt Verantwortung für sich selbst – und das ist der erste Schritt zu echter innerer Stärke. Und: Gerade die Lücke, die zwischen Wahrnehmung und eigener Reaktion entsteht, ist die Chance, die eigene Kommunikation zu wählen, also nicht ausgeliefert zu sein.
So zeigt sich, dass Grenzen nicht zuerst im Kopf entstehen, sondern im Körper erlebt werden – und erst danach in Sprache oder Handlung Ausdruck finden. Die Embodiment-Forscher Wolfgang Tschacher und Thomas Fuchs beschreiben Selbstwahrnehmung und körperliche Resonanz als Grundlage dafür, authentisch in Beziehung treten zu können, ohne sich selbst zu verlieren.

Sie knüpfen damit an das Konzept der Achtsamkeit an: im gegenwärtigen Augenblick präsent zu sein – mit allem, was sich zeigt. Gerade unter Druck oder Stress scheint das schwer, weil alte Schutzmuster greifen. Doch Präsenz ist trainierbar, indem wir unsere Wahrnehmung für den Körper schulen. Jeder Moment, in dem wir innehalten, spüren, atmen und uns selbst wieder wahrnehmen, ist ein Schritt hin zu mehr Selbstfürsorge und innerer Klarheit.
Wenn Sie jetzt merken, dass Sie am liebsten einen schnellen Tipp hätten wie "Was kann ich sagen, damit meine Grenze nicht überschritten wird?" oder "Wie kann ich meinem Kind verbal eine Grenze setzen?", dann muss ich Sie an dieser Stelle um Geduld bitten. Ohne Selbstwahrnehmung helfen aufgesagte Sätze nichts. Das Gegenüber spürt, ob die Grenze eine Abwehr oder ein Gegendruck ist. Wie reagieren sie darauf? Natürlich mit einer neuen Grenze. Und dann geht alles von vorne los.
Also: GEDULD!
3 | Grenzen als Kontaktfunktion – Gestalttherapie
In der Gestalttherapie, die in den 1940er Jahren von Fritz Perls, Laura Perls und Paul Goodman entwickelt wurde, wird der Begriff Grenze ganz zentral verstanden – jedoch nicht als trennende Linie, sondern als Kontaktfunktion.
Die Gestalttherapie beschreibt den Menschen als ein offenes System, das ständig in Beziehung zur Umwelt steht. „Kontakt" entsteht genau an der Grenze zwischen Organismus und Umwelt – dort, wo das „Ich" dem „Du" begegnet.
Die Grenze ist also kein Zaun, sondern eine lebendige Membran. Sie ermöglicht Begegnung, Austausch und Rückzug. Sie gestaltet unsere Beziehungsfähigkeit.
Wenn diese Kontaktgrenze zu durchlässig oder zu starr ist, geraten wir aus dem Gleichgewicht: Wir verlieren uns im anderen – oder kapseln uns zu sehr ab. Deshalb ist einfach NEIN SAGEN eine trennende Art, Grenzen zu setzen. Sie kann notwendig sein (ich betrachte hier keine schweren Übergriffe oder gewalttätigen Situationen!), aber eine Veränderung erreichen wir nicht. Wir erleben nur Kontaktschmerz. Und das Gegenüber möglicherweise ebenfalls. Wenn wir Grenzen falsch oder gar nicht setzen, können als Folge starke Selbstzweifel entstehen, die das Leben dauerhaft belasten.
Beziehungsfähigkeit entsteht, wenn wir eine Situation ausbremsen, um dann eigene Bedürfnisse zu spüren, die Bedürfnisse des anderen zu erkennen. Aus diesen beiden Prozessen entsteht dann das, was ich dem anderen mitteilen möchte.
Wie Grenzsetzung erfahren wird
Kinder setzen Erwachsenen Grenzen durch Schreien, Wut, Rückzug, Trotz oder aggressives Verhalten. Erwachsene ihnen dann wiederum Grenzen durch impulsive Reaktionen, herabsetzende Worte oder lautes Schimpfen.
Ähnliches gilt in Paarbeziehungen: wenn man den automatischen Reaktionskreislauf auf bestimmte Äußerungen oder spezifisches Verhalten des Partners nicht unterbrechen kann, bilden sich Muster in der Paarbeziehung, die dann zu ungesunder Kommunikation und Spannungen führen kann. Der Kontakt zum Gegenüber ist zum Schmerz geworden.
Grenzen ohne Verständigung sind wie eine Trennung, bei der man den Grund nicht versteht. Deshalb ist es so wichtig, gesunde und verstehbare Grenzen zu setzen. Denn die machen Beziehungen möglich, indem Bedürfnisse verstanden und adäquat auf diese reagiert werden kann.
Wenn Sie spüren, dass Sie allein in Ihrem Beziehungsthema oder in der Erziehung überfordert sind, dann kann eine Psychologische Beratung eine hilfreiche Unterstützung sein.
3.1 | Grenzen setzen in der Beziehung
Grenzen setzen in der Beziehung ist eine der anspruchsvollsten zwischenmenschlichen Aufgaben – weil hier Nähe und Eigenständigkeit gleichzeitig gewahrt werden müssen. Viele Menschen haben Angst, durch Grenzen setzen in der Beziehung die Partnerschaft zu gefährden oder als egoistisch wahrgenommen zu werden.
Doch das Gegenteil ist der Fall: Wer in einer Beziehung keine gesunde Grenzen setzen kann, verliert sich selbst – und damit auch die Fähigkeit zur echten Begegnung.
Warum gesunde Grenzen Beziehungen stärken
In Paarbeziehungen entstehen Konflikte oft dann, wenn einer oder beide Partner ihre eigenen Bedürfnisse dauerhaft zurückstellen. Statt klare Grenzen setzen zu können, wird geschwiegen, ausgewichen oder aggressiv reagiert. Das führt zu Mustern, die sich verfestigen: Der eine fordert, der andere zieht sich zurück. Oder beide kämpfen um die Kontrolle, ohne wirklich miteinander in Kontakt zu sein.

Besonders in toxischen Beziehungen ist Grenzen setzen überlebensnotwendig. Toxische Dynamiken zeichnen sich dadurch aus, dass Grenzen systematisch überschritten, missachtet oder lächerlich gemacht werden. Wer in einer solchen Konstellation lernen möchte, eigene Grenzen in einer toxischen Beziehung zu setzen und zu wahren, braucht oft professionelle Unterstützung, um nicht in alte Muster zurückzufallen.
Wie Grenzen in der Beziehung gelingen
- Grenzen setzen ohne zu verletzen: Statt Vorwürfe zu machen („Du machst immer…"), die eigene Grenze benennen: „Ich merke, dass mir das zu viel wird. Ich brauche…"
- in der Beziehung Grenzen setzen bedeutet nicht Abgrenzung gegen den anderen, sondern Kontakt zu sich selbst
: „Ich will dir nahe sein – und dafür brauche ich auch Raum für mich."
- Grenzen setzen und loslassen: Akzeptieren, dass der Partner seine eigenen Grenzen haben darf, ohne dass ich mich abgelehnt fühlen muss.
Grenzen in der Beziehung zu setzen bedeutet, reif zu lieben: mit Klarheit, Respekt und der Bereitschaft, im Kontakt zu bleiben – auch wenn es unbequem wird.
4 | Selbst-Training mit den eigenen Körperreaktionen
Zurück zum Körper. Aus unserer Haltung, Mimik und Gestik können Kinder wie Erwachsene intuitiv spüren und ablesen, wie wir zu ihnen stehen, wie es uns im aktuellen Augenblick geht. Der Körper vermittelt also nicht nur Informationen über eigene Gefühle, sondern auch Informationen über die Beziehung.
Er ist als Resonanzraum nach innen für seelische Vorgänge und nach außen als Beziehungssensor zu verstehen.
Als ersten wichtigen Schritt, eigene Grenzen wahrzunehmen besteht darin, den eigenen körperlichen Ausdruck wahrzunehmen und da sein zu lassen, ohne ihn sofort zu verändern oder zu bewerten. Immer im Hinterkopf dabei zu haben, dass das Gegenüber, ob klein oder groß, diese Grenze ebenfalls wahrnimmt!
Wenn wir z. B. Enge, Zittern oder Müdigkeit spüren, dürfen diese Empfindungen zunächst einfach sein. In der Körperwahrnehmung müssen wir unsere Gedanken oder Reaktionen auf diese Empfindungen ausblenden. Das ist ein Teil des Selbst-Trainings.
Im Annehmen dieser Empfindungen entsteht Selbstkontakt – und damit die Fähigkeit, Grenzen zu spüren, bevor sie verletzt werden. Den Selbstkontakt zu halten, besonders bei unangenehmen Empfindungen, ist die erste Übung. Wenn die sicher eingeübt ist, kann der Weg zu sicheren Grenzen setzen weitergehen.
4.1 | Übung: Den Selbstkontakt spüren
Hier ist die erste Übung zum Selbstkontakt. Nehmen Sie sich 10 Minuten täglich für 2 Wochen. Sie werden eine Veränderung spüren! Alle Übungen sind in Du-Form.
1️⃣ Bequeme Haltung finden
- Setze dich auf einen Stuhl oder lege dich hin.
- Stelle beide Füße fest auf den Boden.
- Lass die Hände locker auf den Oberschenkeln oder neben dem Körper ruhen.
- Schließe, wenn möglich, die Augen.
Tipp: Atme 2–3 Mal tief ein und aus, um anzukommen.
2️⃣ Den Körper als Grenze erkunden
- Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Haut und die Außenseite deines Körpers – dort, wo du dich „vom Raum abgrenzt".
- Nimm bewusst wahr:
- Welche Körperstellen fühlen sich eng, fest oder angespannt an?
- Welche Stellen fühlen sich locker, offen oder leicht an?
Erinnerung: Alle Empfindungen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern wichtige Informationen über deine Bedürfnisse und Grenzen.
3️⃣ Gefühle wahrnehmen, ohne zu bewerten
- Frage dich innerlich:
- „Welche Gefühle tauchen jetzt auf?"
- „Wo spüre ich vielleicht Unruhe, Enge, Angst oder Anspannung?"
- Nimm die Empfindungen einfach wahr, ohne sie verändern zu wollen.
- Denke: Gefühle sind keine Bedrohung – sie zeigen nur, wo meine Grenze liegt.
4️⃣ Bewegung einsetzen
- Hebe die Schultern leicht an, lass sie wieder fallen.
- Strecke die Arme aus, ohne Spannung aufzubauen, und bringe sie wieder zurück.
- Lege die Hand auf Brust oder Bauch und spüre, wie sich die Grenze beim Atmen bewegt.
Beobachte:
- Welche Position gibt dir Halt und Sicherheit?
- Wo fühlt sich Öffnung angenehm an, wo eher unangenehm?
5️⃣ Abschluss und Integration
- Atme noch 2–3 Mal tief ein und aus.
- Öffne langsam die Augen.
- Nimm einen Moment wahr, wie klarer, stabiler oder entspannter du dich jetzt fühlst.
- Wenn du möchtest, schreibe dir kurz auf:
- Wo habe ich meine Grenze deutlich gespürt?
- Wo habe ich Gefühle vielleicht unterdrückt?
- Welche kleinen Signale kann ich im Alltag beachten?
4.2 | Grenzen im Alltag spüren – Selbstkontakt in stressigen Situationen halten
Oft merken wir erst im Nachhinein, dass wir unsere Grenzen überschritten haben – z. B. im Streit mit dem Partner, beim Stress im Job oder in hektischen Familiensituationen. Das Ziel ist, bereits während der Situation präsent zu bleiben, statt sich von Emotionen überwältigen zu lassen.
1️⃣ Ankommen trotz Stress
- Stoppe innerlich für einen Moment, auch wenn nur 5–10 Sekunden.
- Atme bewusst ein und aus.
- Spüre deine Füße auf dem Boden oder deinen Kontakt zum Stuhl/Untergrund.
Das nennt man in Embodiment-Ansätzen grounding – sich körperlich erden, bevor man reagiert.
2️⃣ Selbstkontakt herstellen
- Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper: Schultern, Brust, Bauch.
- Frage dich innerlich: „Wo spüre ich gerade meine Grenze?"
- Enge im Brustkorb → Emotionale Belastung
- Spannung im Nacken → Überforderung oder Druck
- Kribbeln, Unruhe → Aufmerksamkeit auf den Moment lenken
Erinnerung: Gefühle = Signale, keine Bedrohung. Sie zeigen nur, wo deine Grenzen berührt werden.
- Lege ggf. eine Hand auf Brust oder Bauch, um die Verbindung zu dir selbst zu verstärken.
- Spüre, wie Atem und Körper dich stabilisieren – du bist noch in deinem Körper präsent, auch wenn außen Stress herrscht.
3️⃣ Kurze körperliche Mini-Übungen
Wenn die Situation es zulässt, kannst du kleine Bewegungen einbauen, um die Grenze bewusst wahrzunehmen:
- Schultern leicht nach hinten rollen → öffnet die Brust, bringt Klarheit
- Arme kurz strecken oder Hände öffnen und schließen → zeigt die aktuelle Spannungszone
- Tief in den Bauch atmen → bringt Erdung und Ruhe zurück
Diese Mini-Übungen sind wie Signalverstärker für die eigene Grenze. Sie erinnern dich daran, dass du immer einen Kontaktpunkt zu dir selbst hast.
4️⃣ Innere Klarheit und Handlung
Wenn du spürst, dass deine Grenze erreicht ist:
- Sage innerlich „Stopp" oder „Ich brauche gerade Raum".
- Überlege, welche Handlung angemessen ist:
- Kurze Pause nehmen
- Inneren Abstand schaffen
- Klare Worte finden für das eigene Gefühl und das Bedürfnis
- Dein Gegenüber wahrnehmen: Aus welchem Bedürfnis handelt dein Gegenüber? Was genau löst den Kontaktschmerz? Versuche, das zu benennen.
Wichtig: Selbstkontakt bedeutet nicht automatisch Reaktion, sondern Wahrnehmung und Entscheidungskraft.
4.3 | Grenzen mit Worten setzen
Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, sicher in den eigenen Selbstkontakt zu kommen und auch unter Stress präsent zu bleiben, können Sie im folgenden Schritt Grenzen mit Worten setzen üben, aber dabei mit dem Gegenüber in Beziehung zu bleiben.
Wenn du Enge im Brustkorb spürst (emotionale Belastung)
(Du fühlst dich verletzt, traurig oder überfordert im Gespräch)
Mit Erwachsenen:
- „Ich merke, das Thema belastet mich gerade. Ich brauche einen Moment, um durchzuatmen."
- „Ich möchte das Gespräch kurz unterbrechen – mir wird das gerade zu viel."
- „Ich kann das gerade nicht aufnehmen, können wir später weitersprechen?"
- „Ich merke, das Thema macht mich gerade traurig. Ich brauche kurz Zeit, um ruhig zu werden."
Nach jeder Grenzsetzung ist es empfehlenswert, einen Vorschlag zu machen, wie und wann das Gespräch wieder aufgenommen wird, damit die Beziehung nicht abreißt.
Mit Jugendlichen:
- „Ich merke, das Gespräch wird mir gerade zu viel. Ich will keinen Streit, ich brauche kurz Abstand.Dann kann ich meine Gedanken besser sammeln."
- „Ich bin gerade traurig oder verletzt – lass uns später weitersprechen, wenn ich ruhiger bin."
- „Ich merke, ich bin gerade emotional ziemlich voll. Ich will kurz runterkommen, bevor ich etwas sage, das ich bereue."
- „Ich will dir zuhören, aber im Moment bin ich zu aufgewühlt."
Oft ist es hilfreich, konkrete eine neue Zeit (z.B. in 15 Minuten) für ein Gespräch auszumachen und den Ort zu wechseln, damit man wieder frisch in ein Gespräch starten kann. Es reicht auch einfach nur, den Raum zu wechseln.
Mit Grundschulkindern:
- „Ich merke, ich bin gerade traurig/wütend. Ich brauch kurz, um wieder ruhig zu werden."
- „Ich mag dich, aber ich bin gerade nicht ruhig genug, um nett zu sprechen."
- „Ich merke, mir wird das gerade zu viel. Ich brauch kurz Zeit, um ruhig zu werden."
- „Ich bin traurig oder angespannt, und ich möchte erst durchatmen, bevor wir weiterreden."
- „Ich mag dich sehr, aber ich kann gerade nicht gut zuhören. Lass uns in fünf Minuten weitermachen."
Es ist sehr hilfreich, Grundschulkindern eine Tätigkeit zur Überbrückung vorzuschlagen, damit sie in der Wartezeit bis zur Neuaufnahme des Gesprächs ebenfalls in einen entspannteren Zustand gelangen.
Mit Kleinkindern:
- „Mama/Papa ist gerade traurig. Ich muss kurz atmen, dann bin ich wieder da."
- „Ich bin grad müde, ich brauch kurz Pause."
➡️ Wirkung: Du zeigst, dass du für deine Gefühle Verantwortung übernimmst. Das Kind spürt: Mama/Papa geht's grad schwer, aber sie/er bleibt liebevoll und ehrlich.
Bei Spannung im Nacken und Überforderung oder Druck
(Du fühlst dich gestresst, kontrolliert, zu viel Verantwortung oder Lärm)
Mit Erwachsenen:
- „Ich merke, das ist mir zu viel auf einmal. Ich brauche eine Pause, um klar zu denken."
- „Das ist mir gerade zu viel auf einmal. Ich brauche etwas Zeit, um das zu sortieren."
- „Ich fühle mich unter Druck gesetzt – ich möchte das in meinem Tempo entscheiden."
- „Ich kann das nicht alles gleichzeitig leisten, ich muss etwas davon verschieben."
Mit Jugendlichen:
- „Ich bin gerade überfordert. Ich will dich nicht anmeckern – ich brauche kurz Ruhe, bevor wir weiterreden."
- „Ich merke Druck in mir – ich brauch Zeit, um das richtig zu besprechen."
Mit Grundschulkindern:
- „Ich bin grad gestresst. Ich muss kurz tief atmen, bevor ich dir helfe."
- „Ich merk, mein Kopf ist voll – ich brauch kurz, um wieder ruhig zu werden."
- „Ich merke, ich werde gerade gestresst. Lass uns das langsamer machen."
- „Ich brauche kurz, um nachzudenken – bitte warte einen Moment."
Mit Kleinkindern:
- „Mama/Papa ist müde. Ich muss kurz verschnaufen, dann spielen wir weiter. Möchtest du dich mit mir ausruhen oder mit deinem Spielzeug spielen, bis ich wiederkomme?"
- „Ich brauche kurz eine Pause, dann bin ich wieder da. Möchtest du in der Zwischenzeit ein Bild malen?"
Wirkung: Das Kind erlebt, dass Überforderung nichts Gefährliches ist – man darf sie benennen, ohne jemanden zu verletzen. Und während man seinem eigenen Bedürfnis folgt, darf das Kind eine andere Aktivität weiterführen. So bleibt die Situation im Fluss und wird nicht blockiert.
Wenn du Kribbeln oder Unruhe spürst (Ablenkung, Reizüberflutung)
Gegenüber Erwachsenen:
- „Ich merke, ich bin unruhig – können wir kurz frische Luft schnappen?"
- „Ich brauche einen Moment, um wieder bei mir anzukommen."
- „Ich höre dich, aber mein Kopf ist gerade zu voll. Lass uns kurz unterbrechen."
Gegenüber einem Kind:
- „Ich merke, ich bin unruhig – ich muss kurz tief atmen, dann höre ich dir besser zu."
- „Ich kann mich gerade schwer konzentrieren, lass uns kurz durchatmen."
- „Ich will dir zuhören, aber mein Kopf ist gerade laut. Gib mir kurz einen Moment."
5 | Grenzen setzen lernen – Ein Prozess, kein Zustand
Grenzen setzen lernen ist keine Fähigkeit, die man einmal erwirbt und dann für immer beherrscht. Es ist ein fortlaufender Prozess der Selbstwahrnehmung, der Reflexion und der Übung. Wer lernen möchte, Grenzen zu setzen, braucht vor allem eins: Geduld mit sich selbst.
Warum fällt es so vielen Menschen schwer, Grenzen zu setzen?
Die Gründe dafür liegen oft in der eigenen Biografie:
- Frühe Prägung: Wer als Kind gelernt hat, dass die eigenen Bedürfnisse unwichtig sind oder dass Grenzen setzen zu Liebesentzug führt, trägt diese Muster oft ins Erwachsenenalter.
- Angst vor Ablehnung: Viele Menschen befürchten, dass sie durch das Setzen eigener Grenzen andere verletzen oder zurückgewiesen werden.
- Perfektionismus: Der Wunsch, es allen recht zu machen, verhindert klare Abgrenzung.
- Fehlende Vorbilder: Wer nie erlebt hat, wie gesunde Grenzen aussehen, muss diese Fähigkeit von Grund auf neu erlernen.
Wie funktioniert der Lernprozess?
Grenzen setzen lernen ist wie das Erlernen einer neuen Sprache: Am Anfang fühlt es sich ungewohnt und holprig an. Mit der Zeit wird es natürlicher.
Phase 1: Bewusstwerdung
Der erste Schritt besteht darin, überhaupt zu erkennen, wo eigene Grenzen sind:
- Wo spüre ich Unbehagen?
- In welchen Situationen sage ich Ja, obwohl ich Nein meine?
- Welche Beziehungen oder Situationen kosten mich besonders viel Energie?
Phase 2: Körperliche Wahrnehmung schulen
Wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben: Eigene Grenzen setzen beginnt mit der Fähigkeit, körperliche Signale wahrzunehmen. Nutze die Übungen aus Kapitel 4, um deinen Selbstkontakt zu stärken.
Phase 3: Kleine Schritte wagen
Beginne mit kleinen, risikoarmen Situationen:
- „Nein, ich möchte keinen Kaffee. Anstatt dessen nehme ich…” Es ist wichtig, nach einer Grenze einen neuen Raum zu öffnen, nur so bleibt man in Beziehung!
- „Ich brauche heute Abend Zeit für mich. Und morgen erzähle ich dir gerne, welche Gedanken ich hatte und was mich beschäftigt hat."
- „Bitte unterbrechen Sie mich nicht, ich möchte meinen Gedanken zu Ende bringen. dann höre ich gerne Ihr Feedback dazu."
Phase 4: Reflexion und Anpassung
Nach jeder Grenzsetzung ist es hilfreich, zu reflektieren:
- Wie hat sich die Grenze angefühlt?
- Wie hat das Gegenüber reagiert?
- Was würde ich beim nächsten Mal anders machen?
Phase 5: Integration und Festigung
Mit der Zeit wird Grenzen zur inneren Haltung. Du spürst deine Grenzen automatisch und kommunizierst sie klar, ohne dich rechtfertigen zu müssen.
Unterstützung im Lernprozess
- Psychotherapie oder Beratung: Professionelle Begleitung kann helfen, alte Muster zu erkennen und neue Verhaltensweisen einzuüben.
- Selbsthilfegruppen: Der Austausch mit anderen, die ähnliche Herausforderungen haben, kann entlastend und bestärkend wirken.
- Bücher und Ressourcen: Es gibt viele hilfreiche Bücher zum Thema Buch Grenzen setzen, die praktische Übungen und theoretisches Wissen verbinden.
- Coaching und Workshops: Eine Coachingübung zum Grenzen setzen in einem geschützten Rahmen kann helfen, neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Viele Therapeuten und Coaches nutzen auch Arbeitsblätter zum Grenzen setzen wie ein habit tracker als strukturierte Hilfe zur Selbstreflexion.
Wichtig: Lernen Grenzen zu setzen bedeutet nicht, über Nacht perfekt darin zu werden. Es bedeutet, jeden Tag ein klein bisschen mehr bei sich selbst zu bleiben – und das ist bereits ein großer Erfolg.
6 | Fazit
Grenzen setzen ist keine Frage von Egoismus oder Härte – es ist ein Akt der Selbstfürsorge, Klarheit und Beziehungsfähigkeit. Gesunde Grenzen trennen nicht, sondern ermöglichen echte Begegnung – mit uns selbst und mit anderen.
Die zentrale Erkenntnis dieses Artikels: Grenzen entstehen nicht zuerst im Kopf, sondern im Körper. Wer lernen möchte, klare Grenzen zu setzen, muss zunächst die eigenen körperlichen Signale wahrnehmen und respektieren. Embodiment, Achtsamkeit und Selbstkontakt sind die Grundlagen für authentische Grenzsetzung.
Was wir gelernt haben:
- Grenzen beginnen im Körper (Kapitel 2): Enge, Spannung, Unruhe oder Weite sind körperliche Signale, die uns zeigen, wo unsere Grenzen liegen.
- Grenzen sind Kontaktflächen (Kapitel 3): Die Gestalttherapie lehrt uns, dass Grenzen keine Mauern sind, sondern lebendige Membranen, die Begegnung erst möglich machen.
- Selbstkontakt ist der Schlüssel (Kapitel 4): Nur wer präsent bei sich selbst bleibt, kann klar kommunizieren und handeln – auch unter Stress.
- Worte sind Werkzeuge (Kapitel 4): Konkrete Formulierungen helfen, Grenzen klar und respektvoll zu kommunizieren.
- Grenzen setzen ist erlernbar (Kapitel 5): Es ist ein Prozess, der Geduld, Übung und Selbstmitgefühl erfordert.
Der Weg nach vorn
Selbstkontakt in Stresssituationen zu halten heißt, die eigene Grenze im Körper zu spüren, Gefühle als Signale zu verstehen und daraus bewusst zu handeln.
Wer seine Grenzen bewusst wahrnimmt, reagiert klar, ruhig und selbstbestimmt, statt sich in Stress oder Schuldgefühlen zu verlieren. Körper, Atem und Aufmerksamkeit sind dabei die besten Verbündeten, um jederzeit wieder bei sich selbst anzukommen.
Erst im Selbstkontakt finden wir die richtigen Worte, um uns gesund abzugrenzen und trotzdem kommunikationsfähig zu bleiben. So wirkt die Grenze nicht trennend, sondern klärend.
Grenzen setzen lernen bedeutet nicht, über Nacht perfekt darin zu werden. Es bedeutet, jeden Tag ein klein bisschen mehr bei sich selbst zu bleiben – und das ist bereits ein großer Erfolg.
Wer seinem Bedürfnis nach Rückzug, Pause oder Überdenken folgen kann, wer eigene Grenzen setzen und wahren kann, der schützt nicht nur die eigene Energie, sondern kann authentischer und freier in Beziehung sein – zu sich selbst, zu Partnern, zu Kindern, zu Kollegen und zur Familie.
Grenzen sind keine Mauern. Sie sind Brücken zur Selbstbestimmung.
Weiterführende Artikel: Wenn Sie tiefer in die Arbeit mit inneren Mustern eintauchen möchten, lesen Sie auch über die Schematherapie oder erfahren Sie, wie Sie mit Zukunftsängsten umgehen können.

Professionelle Unterstützung beim Grenzen setzen
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, gesunde Grenzen in Beziehungen oder im Umgang mit Kindern zu setzen, unterstütze ich Sie dabei, Selbstkontakt und klare Kommunikation zu entwickeln – für mehr Klarheit und innere Ruhe.
Beratungstermin vereinbaren